Die am
weitesten verbreitete Methode im Rahmen des Neugeborenen-Hörscreenings
ist die Messung transitorisch evozierter Otoakustischer Emissionen
(TEOAE). Diese Messung beruht auf der Tatsache, dass die äußeren
Haarzellen im Innenohr die Fähigkeit zu einer aktiven Eigenbewegung
besitzen. Sie sind dadurch in der Lage, selbst Schallreize auszusenden.
Während der mechanisch-elektrischen Schallwandlung wird durch
die aktive Eigenbewegung der Haarzellen eine „retrograde" (rückwärts
laufende) Wanderwelle in der Cochlea ausgelöst. Diese erzeugt
einen sehr leisen Schallreiz, der auf dem gleichen Weg nach außen
gelangt, auf dem der Luftschall das Innenohr erreicht. Über
ein sehr empfindliches Mikrofon kann die Schallaussendung im Gehörgang
aufgenommen werden.
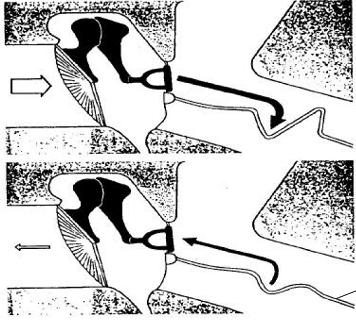
Quelle: http://www.gnotometrics.de/
Die Messung
von Screening-OAE’s geschieht mit Hilfe einer speziellen
Messsonde, die mit Hilfe eines Gummistöpsels in den Gehörgang
des Säuglings eingeführt wird. Das daran angeschlossene
Screening-Gerät sendet zunächst über einen kleinen
Lautsprecher in der Messsonde definierte Schallreize aus. Über
ein ebenfalls integriertes Messmikrofon in der Sonde werden die
Schallaussendungen des Innenohres aufgenommen und im Gerät
selbst über ein Mittelungsverfahren mit Hilfe speziell entwickelter
Algorithmen ausgewertet. Die Messung dauert meist nur wenige
Sekunden.

Firma
Fischer-Zoth / MACK Medizintechnik // Lehnhardt, Praxis der Audiometrie
Lassen
sich auf den applizierten Messstimulus hin innerhalb definierter
Grenzen Schallaussendungen des Innenohres nachweisen, so kann dies
als Nachweis der Funktionsfähigkeit der äußeren
Haarzellen interpretiert werden. Dies bedeutet in den meisten Fällen,
dass das Innenohr innerhalb des sprachrelevanten Frequenzbereichs
(etwa zwischen 1 und 4 kHz) keine gravierende Funktionsstörung
aufweist, da ein isolierter Ausfall der inneren Haarzellen äußerst
selten auftritt. Lassen sich in der Testsituation keine OAE nachweisen,
so deutet dies jedoch nicht zwangsläufig auf einen Hörverlust
hin. Die Messung ist sehr störanfällig im Hinblick auf
Umgebungslärm. Zudem können auch vorübergehende
Störungen der Schallleitung, z.B. im Rahmen einer Erkältung,
die Messung negativ beeinflussen. Gerade in den ersten zwei bis
drei Lebenstagen können sich zudem noch Reste von Fruchtwasser
und Gewebe aus dem Mutterleib im Gehörgang des Säuglings
befinden, welche sich dann auch häufig negativ auf die OAE-Messungen
auswirken.
Die Messung Otoakustischer Emissionen lässt zudem keine Aussage über
die Funktion des Hörnervs und der Hörbahn zu. Um diese zu überprüfen,
können akustisch evozierte Hirnstammpotentiale (BERA
oder ABR) gemessen werden.
Otoakustische
Emissionen können auch spontan auftreten (SOAE), sie besitzen
dann jedoch keine Relevanz für die Diagnostik von Hörstörungen.

